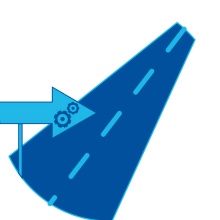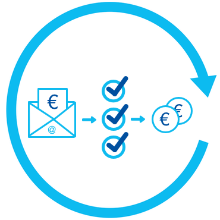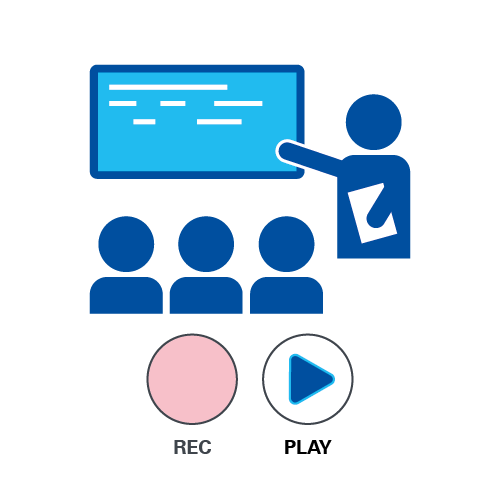Übersicht
Hochschulinterne Infrastruktur- und Digitalisierungsprojekte bestimmen die Arbeit in unseren Abteilungen zu einem erheblichen Teil. Durch sie bringen wir die notwendigen Innovationen in die Breite und die Digitalisierung nah an die Endanwender heran. Mit diesen stehen wir in einem regen Austausch und arbeiten eng verzahnt mit ihnen zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit heraus resultieren neue Dienste des TIK.
Insbesondere durch moderne, leistungsfähige Netztechnologien entstehen völlig neue Möglichkeiten der Bereitstellung von IT-Diensten. Besonderes Augenmerk hat dabei Digitalisierung in einem doppelten Sinne:
- Ganz konkret im Sinne der Digitalisierung von Informationsübertragung, welche insbesondere die Gebäudetechnik immer mehr in den Bereich der IP-Technologie bringt. Das betrifft beispielsweise die Telefonie und die Medientechnik in Hörsälen.
- Allgemein aber auch Digitalisierung als Entwicklung unserer Zeit, die als Medienrevolution unser aller Arbeitsweisen verändert und neue Kompetenzen voraussetzt.
Wir sind technischer Partner für die Umsetzung des Digitalisierungsprogramms der Universität. Ob digitaler Rechnungsworkflow, digitale Zeiterfassung, digitales Reisemanagement oder die Einführung eines neuen ERP-Systems: Das TIK gestaltet die digitale Zukunft der Universität mit und ist enger Partner der Fachabteilungen.
Basisdaten Znuny
Projektstatus:
Fortlaufend
Zentrales Servicedesk-System Znuny
Das IZUS/TIK betreibt seit längerem das Open Source Tool Znuny (www.znuny.org, ehemals OTRS) als zentrales Servicedesk-System zur effizienten Bearbeitung von Anfragen. Bislang wurde Znuny für Anfragen zu TIK-Diensten, an die UB oder zum Studium eingesetzt.
Mit einem Servicedesk-System können z.B. Anfragen oder Störungsmeldungen zentral erfasst und systematisch bearbeitet werden. Anfragen können per E-Mail an eine Support-Maildresse, per Telefon oder per Online-Formular gestellt werden. Der aktuelle Stand der Bearbeitung einer Anfrage ist für die Bearbeiter oder die Bearbeiterinnen sichtbar und je nach Zuständigkeit können die einzelnen Anfragen unterschiedlichen Personen zur Bearbeitung zugewiesen werden. Für die unterschiedlichen Support-Themen können spezifische Antwortvorlagen zur Verfügung gestellt werden, mit denen die Bearbeitung beschleunigt werden kann. Die zentrale Sammlung von Anfragen zeigt auf, welche Fragen häufig und welche selten gestellt werden und ermöglicht somit weitere Optimierungen in den zugrundeliegenden Prozessen.
Im Jahr 2023 arbeitete das TIK daran, die Voraussetzungen zu schaffen, um das Servicedesk-System künftig auch der zentralen Verwaltung und weiteren interessierten Einrichtungen der Universität zur Verfügung zu stellen. Derzeit befindet sich das TIK noch in Gesprächen mit RUS-CERT, der Datenschutzstelle und dem Personalrat. Der erfolgreiche Abschluss dieser Gespräche ist Voraussetzung für den Rollout von Znuny an der Universität.
Einführung eines Energiemanagementsystems: 2024-2025
Das TIK führt zurzeit für die Standorte Allmandring 30a und 30 ein Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50.001:2018 ein. Da das TIK durch den Rechnerraum im Allmandring 30a über dem Grenzwert für die Nennanschlussleistung von 300 kW liegt, ist es nach dem Energieeffizienzgesetz verpflichtet, das Managementsystem bis Juli 2025 einzuführen und sich bis Ende 2025 zertifizieren zu lassen.
Mitte Juli 2024 wurde ein Energieteam gebildet, das sich regelmäßig trifft und mit dem Aufbau des Energiemanagementsystems beauftragt ist. Das Team hat Energieleitlinien erarbeitet, in denen sich das TIK verpflichtet, seine Energieeffizienz im Rahmen seiner technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zu steigern und die damit verbundenen Umweltauswirkungen zu minimieren. In enger Abstimmung mit dem Facility Management der Universität werden strategische und operative Ziele zur Optimierung der Energiebilanz definiert und Maßnahmen zur Erreichung der Energieziele festgelegt. Ziel des Energiemanagementsystems ist es, die Energieeffizienz zu verbessern, nach Möglichkeit den Energieverbrauch zu senken und die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen zu gewährleisten.
Basisdaten Matrix
Projektlaufzeit:
2022 - 2025
Projektstatus:
Fortlaufend
Matrix (2022-2025)
Neues Chatsystem für Lehre und Forschung - Vorarbeiten zur Einführung eines vom TIK betriebenen Chat-Tools für die Kommunikation in Forschung und Lehre.
Zu den Besonderheiten des Dienstes gehört die denzentrale Struktur von Matrix, welche es ermöglicht mit anderen Homeservern (auch mit denen anderer Universitäten, die Matrix verwenden) zu kommunizieren. Des Weiteren stellt Matrix eine End-to-end Verschlüsselung zwischen Kommunikationspartnern sicher, indem es Nutzenden ermöglicht einen eigenen Sicherheitsschlüssel zu nutzen. Dies bedeutet, dass auf den Servern der Universität Nachrichten nur verschlüsselt hinterlegt sind und diese nur durch die betreffenden Kommunikationspartner entschlüsselt werden können. Der korrekte Umgang mit dem Sicherheitsschlüssel ist hierfür wichtig. Nutzende haben die Möglichkeit, über den von der Universität angebotenen Webclient oder über selbst installierte Desktopclients den Dienst zu nutzen. Eigene Clients müssen hierbei über Single-Sign-On Unterstützung verfügen.
Basisdaten
Projektlaufzeit:
Projektstatus:
Fortlaufend
Ausweitung Personalservices
In der zentralen Verwaltung der Universität werden bereits seit einigen Jahren Personal-Online-Services in Form einer elektronischen Zeiterfassung eingesetzt. Das verwendete System der HIS-GmbH hat das Potential für weitere Anwendungen. 2023 wurde das System für die Funktion der Abwesenheitsverwaltung vorbereitet. Die Abwesenheitsverwaltung umfasst derzeit die Beantragung und Freigabe von Erholungsurlaub und Flexibilisierungstagen. Die Möglichkeit, weitere Abwesenheitsarten online beantragen zu können, sind in Planung.
Das System bietet eine übersichtliche Kalenderansicht, in der sowohl die beantragten als auch die bereits genehmigten Abwesenheiten auf den ersten Blick ersichtlich sind. Über diese Kalenderansicht kann auch eine weitere Abwesenheit beantragt werden. In der Übersicht werden außerdem alle weiteren Abwesenheiten dargestellt wie zum Beispiel Kranktage und Sonderurlaub, die vom Dezernat Personal und Organisation bearbeitet werden.
ERP-Modernisierung
Kernpunkte des vergangenen Jahres waren die Implementierung der Fachkonzepte, das Outsourcing des Betriebs sowie der Test des Systems auf Herz und Nieren durch die Uni.
Das Gesamtprojekt „ERP-Modernisierung“ ist in drei Stufen gegliedert. Schwerpunkte der Stufe 1 sind die Umstellung des Kontierungsmodells sowie der Wechsel auf die neueste Softwaregeneration von SAP mit dem Namen SAP S/4HANA. Kerninhalt der Stufe 2 ist die Digitalisierung der Einkaufsprozesse, während Stufe 3 einen großangelegten Roll-Out der neuen Prozesse auf die gesamte Universität vorsieht. Jede Stufe beginnt mit einer Initiierungsphase, der die Design- und Implementierungsphase folgen. Dank dieser Gliederung in Stufen und Phasen kann das Projekt professionell gesteuert werden.
Basisdaten Uni-Maps
Projektlaufzeit:
September 2022 - September 2023
Projektstatus:
Fortlaufend
Projektdetails: Uni-Maps
Das Ziel ist die Erstellung eines neuen Lageplan-Moduls zur Einbindung in Webseiten. Mit dem neuen Lageplan-Modul können Redakteur*innen selbständig eigene Ansichten von Gebäuden oder sonstigen Points of Interest (POI) generieren. Als Datenbasis wird weiterhin Openstreetmap (OSM) benutzt. Die Darstellung ist aber mit modernen Frameworks dreidimensional und frei drehbar. In einer Google-ähnlichen linken Leiste werden Detailinformationen zur jeweiligen Adresse angezeigt. Die ElasticSearch-basierte Suche beinhaltet OSM-Daten als auch ca. 2000 eigene Datenpunkte.
Weitere Projektziele sind:
- Erstellung kuratierter POI-Listen (Gebäude, Hörsäle, Gatronomie, Parkplätze, ..)
- Aufbereitung der Geoinformationen der Universität und angehöriger Einrichtungen
- Regelmäßige und automatisierte Aktualisierung der OSM-Datenbasis
- Frontend für Redakteur*innen zur Wartbarkeit der Daten
- Einbettung in Drittsystemen (OpenCms, C@MPUS)
Basisdaten DRW
Projektdetails: Digitaler Rechnungsworkflow
Den Anstoß für das Projekt „Digitaler Rechnungsworkflow“ (DRW) gab die EU-Richtlinie 2015/55/EU, nach der öffentliche Auftraggeber elektronische Rechnungen empfangen und (medienbruchfrei) verarbeiten können müssen. Kern des Projekts bildet die Beschaffung und Implementierung einer geeigneten Software, mittels derer die Rechnungsbearbeitung und zugehörige Anordnungsprozedur digital erfolgen kann.
Zielsetzung des Projekts (Auszug):
- Einhaltung der formalen Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorgaben nach der EU-Richtlinie 2014/55, EN 16931 und den entsprechenden Bundes- und Landesgesetzgebungen (E-Rechnungsgesetz, E-Rechnungsverordnung)
- Standardisierung des Rechnungsdurchlaufs für eingehende Rechnungen: Der Eingang und die Erfassung von elektronischen und papierbasierten Rechnungen erfolgt an zentraler Stelle. Die Prüfung und Bearbeitung erfolgt in einem elektronischen Workflow unter Vermeidung von Medienbrüchen, bis zu einer Auszahlungsanweisung in SAP und Bezahlung
- Implementierung und Prüfung eines innerbetrieblichen Kontrollverfahrens mit einer revisionssicheren Ablage der Rechnungen nach GoBD
- Schaffung von Transparenz im Rechnungsdurchlauf (zentral & dezentral)
- Vermeidung von Doppelerfassung und Redundanzen sowie zeitliche Verkürzung von Transportwegen, dadurch Aufwandsreduktion und Verkürzung des Rechnungsdurchlaufs und Vermeidung von Skontoverlusten
Basisdaten StuKUS
Projektdetails: StuKUS
Ziel des Projekts Studienwahl-Kompass Universität Stuttgart (StuKUS) ist die Neuaufbereitung der Informationen zu den angebotenen Bachelor-Studiengängen für die Zielgruppe der Studieninteressierten. Durch multimediale und interaktive Darstellung der Inhalte und Anforderungen erhalten die Interessenten einen anschaulichen Eindruck von einem Studiengang. Die Vergleichbarkeit der Studiengänge wird durch ein einheitliches Template gewährleistet. Damit unterstützt der Studienwahl-Kompass die Studieninteressierten bei ihrer Studienorientierung und ermöglicht eine verbesserte Studienwahl.
Basisdaten: bwIPv6@Academia
Finanziert durch:
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK)
Projektlaufzeit:
April 2019 - Dezember 2021
Projektstatus:
- abgeschlossen
Projektpartner:
- Universität Freiburg
- Universität Heidelberg
- Universität Hohenheim
- Universität Konstanz
- Universität Mannheim
- Universität Tübingen
- Universität Ulm
- Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
- Hochschule Heilbronn
- Hochschule für Technik Stuttgart
- Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
- BelWü-Koordination
Weitere Informationen
Projektwebseite https://bwipv6.de/start
Projektdetails: bwIPv6@Academia
Das Projekt bwIPv6@Academia hat die Einführung und Förderung des Internetprotokolls IPv6 an den Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg begleitet.
IPv6 hält mittlerweile, über 20 Jahre nach seiner Standardisierung, Einzug in vielen Bereichen der IT. Für die Universitäten und andere Hochschulen ist es wichtig, diese Entwicklung aktiv zu begleiten und für die Zukunft gewappnet zu sein. Das Landesprojekt bwIPv6@Academia hatte die Aufgabe, den Zustand der IPv6-Fähigkeit gemeinsam mit den teilnehmenden Einrichtungen zu analysieren, Probleme und Aufgaben zu identifizieren, sowie die Umsetzung zu begleiten.
Damit im Anschluss auch weitere Einrichtungen davon profitieren können, wurden die gewonnenen Erkenntnisse, sowie erarbeitete Materialien (z.B. Schulungsunterlagen oder Beispiele) auf docs.bwipv6.de veröffentlicht.
Projektdetails: DaRUS
DaRUS (Datenrepositorium der Universität Stuttgart) beruht auf der OpenSource Software DataVerse und bietet Gruppen der Universität (Instituten, Arbeitsgruppen, SFBs, Projekten) die Möglichkeit, eigene Daten-Universen mit eigenen Suchkriterien und Beschreibungsmöglichkeiten zu pflegen. Die Datensätze werden so beschrieben, dass sie leicht auffindbar und unkompliziert zu teilen sind. Eine API bietet die Möglichkeit, den Upload und den Zugriff auf die Daten zu automatisieren. Die Datensätze müssen nicht veröffentlicht werden, können aber leicht zitierbar und mit DOI versehen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Damit können nicht nur die Anforderungen von Fördermittelgebern oder Zeitschriften erfüllt werden, sondern gleichzeitig wichtige Forschungsergebnisse innerhalb einer Forschungsgruppe sichtbar und langfristig nutzbar gemacht werden.
Basisdaten HS2020
Partner:
Dezernat VI - Technik und Bauten
Entwicklungsstatus:
abgeschlossen, in Betrieb überführt
Weitere Informationen:
Projektdetails: HS2020
Im Rahmen des Hörsaalumbau-Projekts HS2020 soll die Infrastruktur von über 100 Hörsälen der Universität Stuttgart erneuert werden. An den Standorten Campus Vaihingen und Stadtmitte werden die Hörsäle nach einem Musterhörsaal-Konzept mit neuer Audio- und Medientechnik sowie Netzwerkarchitektur und Mobiliar ausgestattet. Auf diese Weise werden zudem die Voraussetzungen für ein einheitliches Monitoring der Hörsaaltechnik, Fernwartung und -bedienung geschaffen.
Basisdaten bwCloud
Entwicklungsstatus:
Überführung in Landesdienst
Gefördert durch:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK)
Weitere Informationen:
- Support
Projektdetails: bwCloud
IaaS für Forschung und Lehre in Baden-Württemberg
Das bwCloud-Projekt entwickelt und betreibt eine „Infrastructure-as-a-Service“-Umgebung für Forschung und Lehre in Baden-Württemberg. In der standortübergreifenden Infrastruktur können virtuelle Server und Maschinen betrieben werden. Langfristig wird so das Service Portfolio der teilnehmenden Rechenzentren um die Fähigkeit erweitert, Ressourcen schnell und mit geringem organisatorischen Aufwand für eine breite Anwenderschaft anbieten zu können. bwCloud wird im Rahmen eines Landesdienstes für die Hochschulen und Universitäten Baden-Württembergs zur Verfügung stehen.
Registrierung und Login
Wenn Sie den Dienst zum ersten Mal nutzen, müssen Sie sich zunächst registrieren und ein gesondertes Dienstpasswort setzen:
Registrierte Nutzer können sich unter folgendem Link im bwCloud-Portal anmelden:
Bitte beachten Sie:
Zurzeit liegen noch keine Rahmenbedingungen für IT-Sicherheit und datenschutzkonforme Speicherung und Verarbeitung von sensiblen Daten vor.
Für den Dienst werden sogenannte Entitlements vergeben. Diese regeln, wie viele Ressourcen ein Nutzer nutzen darf. Das Entitlement "bwCloud-Basic" richtet sich dabei hauptsächlich an Studierende und bleibt aufgrund der geringen Ressourcennutzung kostenfrei. Das Entitlement "bwCloud-Extended" stellt mehr Ressourcen zur Verfügung und wird, sobald ein Verrechnungskonzept vorliegt, kostenpflichtig.
Sobald der Dienst verrechenbar ist, wird dies mit einem Vorlauf von 3 Monaten angekündigt. Bis dahin ist der Dienst kostenfrei. Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen zu den Entitlements.
Basisdaten more-Projekt
Projektdetails: more-Projekt
Mobile relaunch der Webauftritte der Universität Stuttgart
Zu Beginn des Jahres 2017 wurden die zentralen Webseiten der Universität Stuttgart auf ein neues Design umgestellt. Mit Projektende im April 2019 befinden sich auch Institute, Fakultäten und Einrichtungen sowie die Inhalte der Verwaltung im neuen Webdesign. Als Teil des more-Projektteams ist das TIK für die technische Umsetzung und die Arbeit mit dem Redaktionssystem OpenCms verantwortlich.
Zielsetzung des more-Projekts:
- Migration von Instituts- und Fakultätswebseiten
- Überführung der Webauftritte der Zentralen Verwaltung in die Struktur der zentralen Uni-Webseiten und Erweiterung des Beschäftigten-Webauftritts
- Migration von Webauftritten zentraler Einrichtungen
sowie
- Erstellung einer Website- und Domain-Policy
- Entwicklung und Umsetzung eines Schulungskonzepts
- Weiterentwicklung des Template 3.0 und der zentralen Uni-Webseiten
- Aufbau von Workflows einer zentralen Online-Redaktion